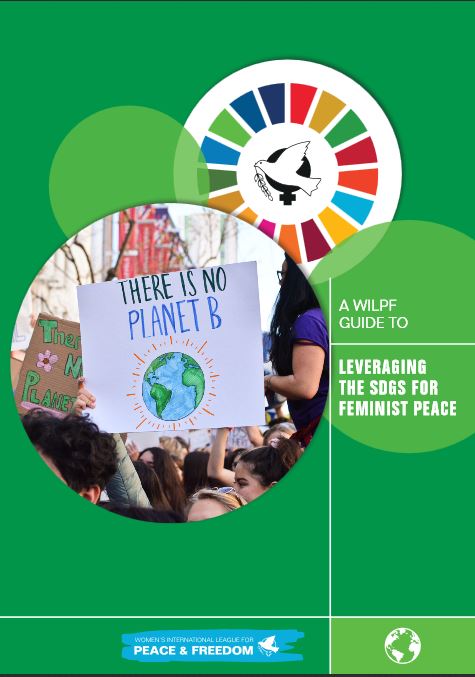
SDGs für feministische Friedensarbeit nutzen
Die WILPF hat einen Leitfaden veröffentlicht für die Arbeit an den Nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable Development Goals, SDGs) aus einer feministischen Friedensperspektive. Er soll Aktivist*nnen helfen, in der Zusammenarbeit mit Regierungen und Zivilgesellschaft die SDGs für Konfliktprävention und menschliche Sicherheit zu nutzen.
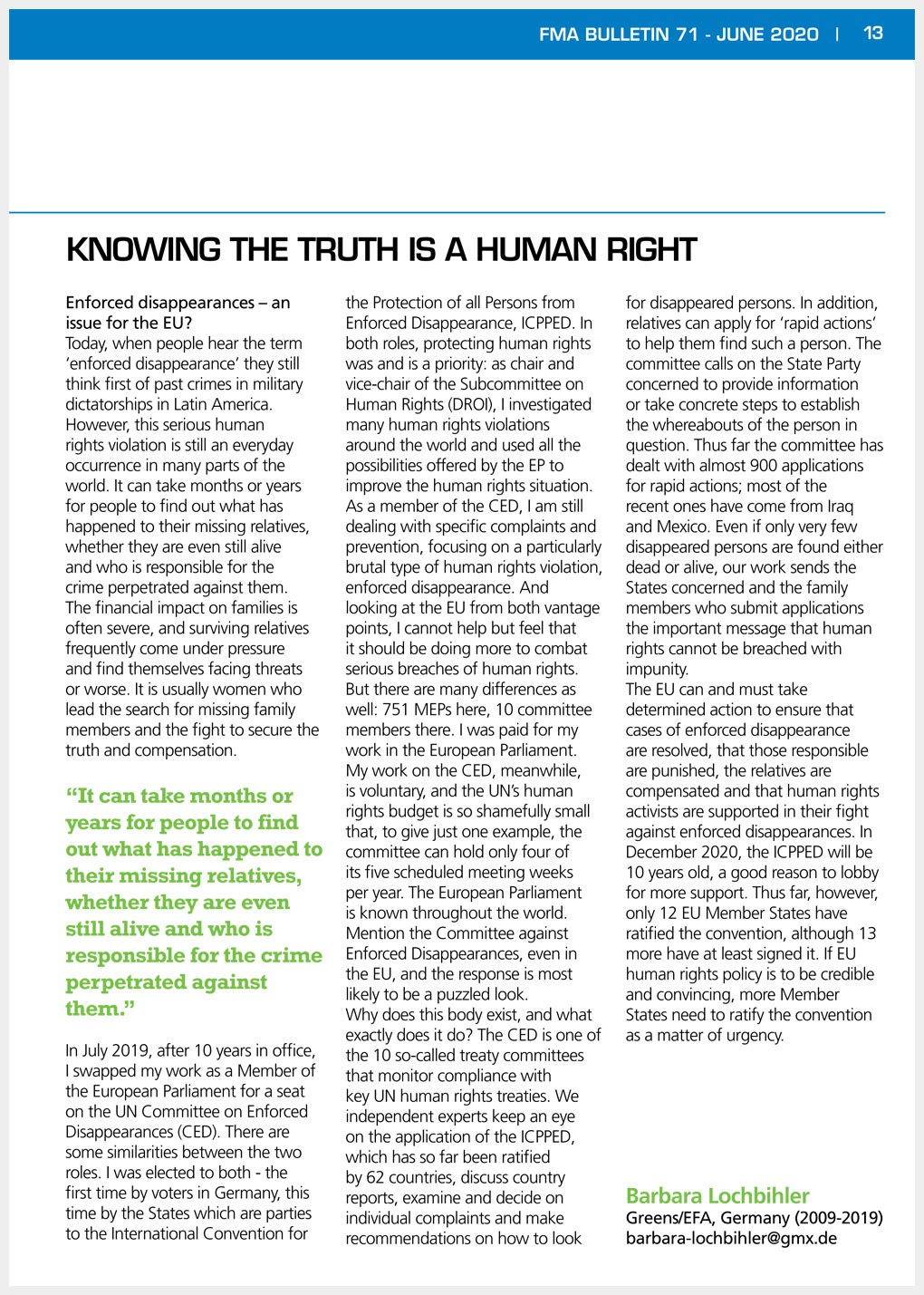
Das Recht auf Wahrheit ist ein Menschenrecht
Für das Bulletin der Vereinigung ehemaliger Europaabgeordneter habe ich einen Beitrag verfasst, warum die EU sich weiterhin gegen das gewaltsame Verschwindenlassen einsetzen muss. Dazu gehört auch, dass mehr als nur bisher 12 Mitgliedsstaaten die Konvention gegen das Verschwindenlassen ratifizieren.
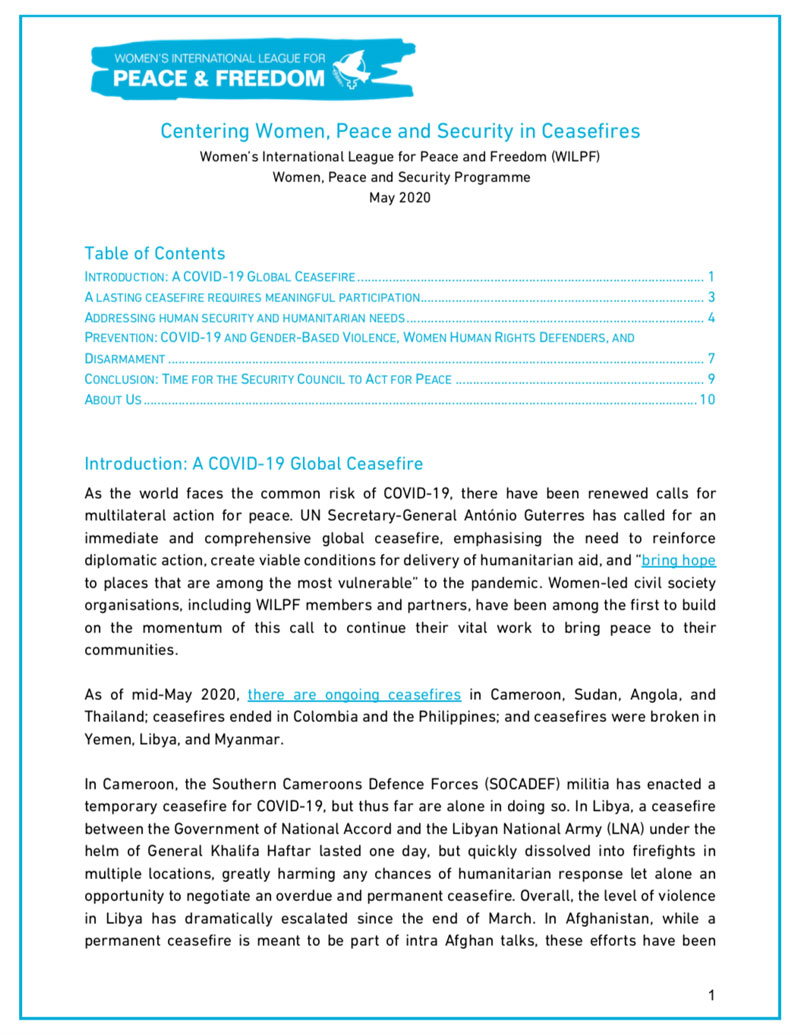
WILPF: “Centering Women, Peace and Security in Ceasefires”
Über zwei Monate ist es inzwischen her, seit UN Generalsekretär Guterres zu einem globalen Waffenstillstand angesichts der Covid-19-Pandemie aufrief. Im Sicherheitsrat gelang es bislang nicht, eine entsprechende Resolution zu verabschieden. WILPF fordert dessen Mitglieder auf, bei allen seinen Aktivitäten die geschlechtsspezifischen Auswirkungen von Konflikten und die wichtige Rolle von Frauen für die Konfliktbeilegung einzubeziehen. Die neue Veröffentlichung „Centering Women, Peace and Security in Ceasefires“ beschreibt auch, wie einzelne Waffenstillstände bereits umgesetzt werden, und wo dies nötiger denn je ist.
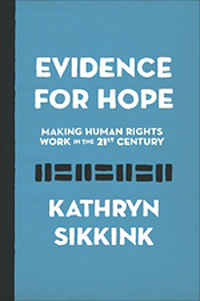
Evidence for Hope – eine persönliche Leseempfehlung
Die Wirkmächtigkeit von Menschenrechtsarbeit wurde in den vergangenen Jahren immer wieder in Zweifel gezogen. Kritik kommt aus der Wissenschaft, aus der Politik, aber auch von Menschenrechtsaktivist*innen selbst. Kathryn Sikkink hat sich in ihrem Buch „Evidence for Hope. Making Human Rights Work in the 21th Century“ detailliert mit deren Argumenten auseinandergesetzt und zahlreiche erfolgreiche Beispiele von Menschenrechtsarbeit analysiert. Ich möchte dieses Buch allen Menschenrechtsinteressierten wärmstens zur Lektüre empfehlen!
Kathryn Sikkink ist Professorin für Menschenrechtspolitik an der Harvard Kennedy School of Government und beschäftigt sich seit Jahren mit Menschenrechtskampagnen und weltweiten menschenrechtpolitischen Entwicklungen. Sie hat sie zahlreiche Analysen und Argumente zusammen getragen, die Erfolge und Wirksamkeit von Menschenrechten dokumentieren, und begegnet damit der oft überzogenen Kritik an der ‚ohnmächtigen‘ Menschenrechtsarbeit und der Behauptung, die Menschenrechtsbewegung habe sich überholt, denn es gäbe noch immer schwerste Menschenrechtsverletzungen.
Besonders interessant fand ich die Ausführungen zu Menschenrechtsaktivist*innen, die besonders kritisch in der Wahrnehmung eigener Erfolge sind. Ziel ihrer Arbeit ist meist die umfassende Verwirklichung von Menschenrechten. Gemessen daran erscheinen Teilerfolge entsprechend als ungenügend. Selbstredend müssen Menschenrechtsorganisationen beständig die eigenen Arbeitsweisen hinterfragen und politischen Entwicklungen anpassen, ebenso ihre Rolle als Teil einer breiten Zivilgesellschaft. Kathryn Sikkink erkennt dies an, macht aber auch deutlich, dass Menschenrechtsaktivismus nur ein – zweifellos wichtiger – Faktor von vielen ist, der letztlich zu Fortschritten beim Menschenrechtsschutz führt. Andere Faktoren sind die wirtschaftliche Entwicklung, demokratische Strukturen und die Abwesenheit von internen und internationalen Kriegen. Sie arbeitet heraus, dass es zu Erfolgen gerade dann kommt, wenn Druck von außen durch internationale nichtstaatliche Organisationen und innerstaatliche zivilgesellschaftliche Interessensgruppen aufeinander treffen und wirkungsvoll zusammenarbeiten.
„Evidence for Hope“ ist ein Fachbuch, in leicht verständlichem Englisch geschrieben und 2017 erschienen. Mir wurde beim Lesen immer wieder deutlich: Verbesserungen beim Menschenrechtsschutz brauchen vor allem Zeit sowie die Bereitschaft sich der Teilerfolge zu vergewissern, und es ist sinnvoll, sich mit den Hintergründen überzogener Kritik im Detail zu beschäftigen, deren politischen Absichten darzulegen und offen dagegen zu argumentieren.

Erstmals öffentliche online Sitzung eines UN Vertragsausschusses
14 Zeitzonen über die Wohnorte der Ausschussmitglieder von Japan bis Peru galt es zu verbinden. Eine Übersetzung konnte nicht realisiert werden mit entsprechenden Einschränkungen für die Ausschussmitglieder und die Zuschauer*innen. Auch weitere technische Herausforderungen waren in der Live-Übertragung nicht zu übersehen, und längst nicht alle Aufgaben des Ausschusses gegen das Verschwindenlassen, wie der Dialog mit Staaten, sind unter diesen Bedingungen und Einhaltung der Geschäftsordnung zu leisten.
Dennoch hat der Ausschuss gestern seine 18. Sitzung online und öffentlich eröffnet, als erster UN Vertragsausschuss überhaupt. Wir wollten damit insbesondere für die Opfer des Verschwindenlassens und ihre Angehörigen ein deutliches Zeichen setzen, dass unsere Arbeit trotz aller Einschränkungen durch die Covid-19-Pandemie weitergeht. Dies lässt sich auch an der kontinuierlich steigenden Zahl von Eilaktionen des Ausschusses (bis heute fast 900) erkennen. Genauso wollten wir den Staaten signalisieren, dass wir sie weiter bei der Umsetzung der Konvention unterstützen bzw. ihre Verpflichtungen weiterhin einfordern werden und keinerlei Entschuldigungen, auch nicht Covid-19, für das gewaltsame Verschwinden von Menschen akzeptiert werden. 19 von 62 Vertragsstaaten haben beispielsweise ihre Erstberichte zur Umsetzung der Konvention noch nicht vorgelegt. Hier werden wir notfalls auch ohne Bericht tätig.
Die öffentliche Sitzung des Ausschusses gegen das Verschwindenlassen kann hier angeschaut werden.

Ausschuss gedenkt der Opfer des Verschwindenlassens
Marie Noemie Barbosa Gonzales aus Kolumbien sucht seit über fünf Jahren nach ihrem Sohn, der im Alter von 32 Jahren im Juni 2014 gewaltsam verschwand. Mit sehr eindrücklichen persönlichen Worten schilderte sie heute im Ausschuss gegen Verschwindenlassen, wie dieser ihr seither mit beharrlichen Nachfragen bei den kolumbianischen Behörden bei der Suche geholfen hat. Leider sei ihr Sohn weiterhin verschwunden, doch das Wissen um die Unterstützung des Ausschusses sei ihr Hilfe und Trost.
Frau Barbosa und ihr Sohn stehen stellvertretend für die unzähligen Opfer des Verschwindenlassens, derer wir in der Eröffnungssitzung gedachten. Der Ausschussvorsitzende wies auch darauf hin, welche Folgen die Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie für die Opfer haben – wenn die Angehörigen ihr Haus nicht verlassen können, um nach der verschwundenen Person zu suchen, oder wenn sie bei Behörden noch mehr als sonst an verschlossene Türen klopfen.
Der Beitrag von Frau Barbosa und die ganze erstmals online durchgeführte Ausschusssitzung können hier angeschaut werden.
Keine Milliardeninvestition in die atomare Aufrüstung Deutschlands
Die WILPF unterstützt den ICAN-Städteappell der Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN), den Vertrag zum Verbot von Atomwaffen zu unterstützen. Zahlreiche Städte, Gemeinde und Landkreise in Deutschland sind diesem Appell bereits gefolgt. Nun haben sie erneut Post von der Kampagne bekommen mit der Bitte, eine Milliardeninvestition in die atomare Aufrüstung Deutschlands zu verhindern – Milliarden, die für die Bewältigung der Corona-Pandemie von den Kommunen dringend gebraucht werden.
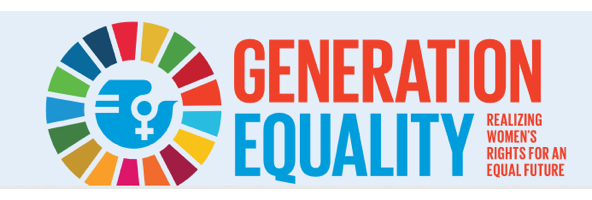
25 Jahre nach Peking: Alternative Feministische Erklärung
Vertreterinnen der WILPF und über 10.000 weitere Frauenrechtsaktivist*innen kamen Anfang März in New York zusammen, um gemeinsam mit Staatenvertreter*innen und anderen Bilanz zu ziehen 25 Jahre nach der Weltfrauenkonferenz in Peking 1995. Anlass dafür war die jährliche Sitzung der Frauenrechtskommission der Vereinten Nationen (Commission on the Status of Women, CSW), die jedoch in Folge der Covid-19-Pandemie von zwei Wochen auf nur einen Tag gekürzt wurde. Zu beraten hätte es reichlich gegeben angesichts der massiven Rückschläge für die Rechte von Frauen, Mädchen und LGBTQ Menschen auf der ganzen Welt und der zunehmend offenen Feindseligkeit vieler Regierungen gegenüber Frauenrechten. Doch es reichte nur für die Verabschiedung einer politischen Erklärung, die enttäuschend und ambitionslos gerade einmal die Verpflichtungen von Peking bekräftigt.
Deshalb hat der Women’s Rights Caucus – eine globale Koalition von über 200 Frauenrechtsorganisationen – dem eine alternative feministische Erklärung entgegengestellt. Dies ist eine ambitionierte feministische Vision, die deutlich macht, was dringend erforderlich ist, um gleiche Rechte, gleiche Chancen, gleichen Schutz für Frauen und Mädchen endlich Realität werden zu lassen.
Übrigens: Eine hervorragende Möglichkeit sich zu informieren, wie es (nicht nur) mit dieser Erklärung weitergeht, ist der Newsletter der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit .

Auf den Spuren der Knochen
Es ist eine Arbeit mit dem Tod, aber vor allem eine Arbeit für die Gewissheit – so schildern die forensischen Anthropologen ihre Arbeit in diesem hörenswerten Beitrag des rbb. Diese Spezialisten identifizieren und analysieren die Überreste von Menschen, die mutmaßlich Opfer von Menschenrechtsverbrechen wurden. Ohne ihre Expertise wäre auch die Aufarbeitung von gewaltsamem Verschwindenlassen in vielen Fällen unmöglich. Der Beitrag schildert die Anfänge dieser Arbeit in Argentinien nach der Militärdiktatur und wie die argentinischen Experten inzwischen in fast 50 Ländern mitgeholfen haben, Opfer zu identifizieren und Angehörigen Gewissheit, bestenfalls sogar Gerechtigkeit zu verschaffen.

Anerkennung für einen Revolutionär aus dem Allgäu
Erst auf den zweiten Blick mit den Menschenrechten verbunden ist eine gute Nachricht, die mich zu Jahresbeginn aus dem Allgäu erreichte: In Immenstadt soll bald ein zentraler Platz nach Fidel Schlund benannt werden. Dort werden zukünftig Bürger*innen und Tourist*innen daran erinnert, dass es bereits 1848 im Allgäu mutige Bürger*innen gab, die sich für grundlegende politische Reformen, Bildung, die Unabhängigkeit der Gerichte und eine freie Presse einsetzten – Forderungen, die nach wenigen Monaten schon die Revolution von 1848 prägten und 100 Jahre später auch zum Bestandteil der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wurden. Fidel Schlund musste nach der gescheiterten Revolution von 1848 das Allgäu verlassen und kämpfte dann an der Seite von Präsident Lincoln gegen die Sklaverei in den USA. Dort ist er auf einer Art Ehrenfriedhof in Newark beerdigt, den ich vor einiger Zeit besuchte.
Mehr über Fidel Schlund und die Revolution 1848 im Allgäu gibt es in dem von mir herausgegebenen Buch „Für die Freiheit: Revolution im Allgäu 1848“ zu lesen:
www.barbara-lochbihler.de/footer-navigation/publikationen/detail-pub/news/es-lebe-die-freiheit-revolution-im-allgaeu-184849/




