
Neue Mitglieder für CED gewählt
Der Ausschuss gegen das Verschwindenlassen wird seine nächste Sitzung im September in neuer Zusammensetzung durchführen. Da für fünf Mitglieder ihr Mandat endet, mussten Nachfolger*innen gewählt werden. Mohammed Ayat aus Marokko, Milica Kolakovic-Bojovic aus Serbien und Horacio Ravenna aus Argentinien wurden für eine zweite Amtszeit gewählt. Aus Ecuador wird Juan Alban-Alencastro künftig mitarbeiten und aus Albanien kommt Janina Suela zurück. Sie war bereits bis 2019 Ausschussmitglied und zuletzt auch dessen Vorsitzende. Es wird also mehr personelle Kontinuität geben als 2017, als mit mir fünf ganz neue Mitglieder in den 10köpfigen Ausschuss kamen. Die nächsten Wahlen stehen nun 2023 an, dann endet auch meine erste Amtszeit.
Gewählt werden die Ausschussmitglieder von den 63 Staaten, die die Konvention gegen das Verschwindenlassen ratifiziert haben. Die Mitglieder werden jeweils für vier Jahre gewählt und können dann einmal wiedergewählt werden. Sie werden zwar von „ihren“ Staaten nominiert, sind mit der Wahl aber von Weisungen unabhängige Expert*innen.

Rückblick auf die 20. Sitzung des CED
Wie sind Menschen in Kolumbien, in der Mongolei und in der Schweiz vor dem gewaltsamen Verschwindenlassen geschützt? Wie werden Fälle aufgeklärt und Verantwortliche zur Rechenschaft gezogen? Dis hat der Ausschuss gegen das Verschwindenlassen in seiner 20. Sitzung vom 12. April bis 7. Mai 2021 überprüft, sich mit NGOs ausgetauscht und eine ganze Reihe weiterer Themen beraten und entschieden. Mein Rückblick auf die Sitzung ist auf der Webseite der Koalition gegen Verschwindenlassen zu lesen.

Opfer von Verschwindenlassen berichtet dem Ausschuss
Reyna Patricia Ambros Zapatero wurde 2018 Zeugin, wie ein junger Mann in Mexiko verschleppt und verschwunden wurde. Als sie begann, Fragen zu stellen und nach ihm zu suchen, wurde sie selbst Opfer des gewaltsamen Verschwindenlassens. Bewaffnete Männern in Marineuniformen verschleppten sie an einen geheimen Ort und folterten sie. Nach drei Tagen wurde sie an einer Straße ausgesetzt, aber ihr und ihrer Familie wurde mit dem Tod gedroht, falls sie weiter auf Demonstrationen oder Anzeige erstatten würde.
Reyna Patricia Ambros Zapatero berichtete ihre Geschichte gestern bei der abschließenden Sitzung des Ausschusses gegen Verschwindenlassen. Sie sei überzeugt, dass das schnelle Eingreifen des Ausschusses gegenüber den mexikanischen Behörden ihr Leben gerettet habe. Gerechtigkeit habe sie aber bis heute nicht erfahren, keine Entschädigung und niemand wurde zur Verantwortung gezogen. Das Schicksal des jungen Mannes, dessen Verschwinden sie beobachtet hatte, sei bis heute ungeklärt.
Mein Kollege Horacio Ravenna sagte, ihre Anwesenheit heute sei ein Beweis dafür, dass internationale Einmischung dazu beitragen kann Leben zu retten. Dies sei Ermutigung und Ansporn für uns, trotz aller Schwierigkeiten nicht nachzulassen und von den Staaten die wirksame Umsetzung der Konvention gegen das Verschwindenlassen zu fordern.
Anschauen kann man Reyna Patricia Ambros Zapateros beeindruckenden Bericht hier (ab Min 22).

Wo sind sie?
Im Videogespräch mit Hannah Shaw von der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit habe ich über meine Arbeit im UN Ausschuss gegen das Verschwindenlassen berichtet. Anlass war der Internationale Frauentag, deshalb ging es auch darum, dass überwiegend Männer gewaltsam verschwinden und es deshalb vor allem Frauen sind, die nach Angehörigen suchen, dabei selbst bedroht werden und sich im Kampf um Wahrheit und Entschädigung organisieren. Gesprochen haben wir auch darüber, warum immer häufiger Migranten und Flüchtende gewaltsam verschwinden. Und was können die Menschenrechtsinstitutionen der Vereinten Nationen dagegen tun?

Schweiz im Dialog mit CED
Gewaltsames Verschwindenlassen in der Schweiz? Warum hat sich der Ausschuss gegen Verschwindenlassen (CED) in seiner aktuellen Sitzung mit diesem Land befasst? Diese schwere Menschenrechtsverletzung wird meist mit Staaten wie Mexiko oder Irak assoziiert. Doch eine wesentliche Absicht der Internationale Konvention gegen das Verschwindenlassen ist es zu verhindern, dass Menschen gewaltsam verschwinden und wenn doch, dass sie schnellstmöglich gefunden werden. Deshalb ist es so wichtig, dass möglichst viele Staaten der Konvention beitreten und sie im eigenen Land mit Gesetzen und Trainings umsetzen. In der Schweiz ist die Konvention 2017 in Kraft getreten und die Regierung musste nun im Dialog mit dem Ausschuss gegen das Verschwindenlassen berichten, welche Maßnahmen zur Umsetzung der Konvention seitdem auf den Weg gebracht wurden. Dabei ging es um den Straftatbestand, um Unterstützung für Opfer oder das Refoulement-Verbot. Thema war aber auch die Aufklärung von lange zurückliegenden illegalen Adoptionen aus Sri Lanka und die Frage, ob diese als gewaltsames Verschwindenlassen gelten. Unser Ausschuss wird den Dialog mit den Schweizer Regierungvertreter*innen sorgfältig auswerten und dann Empfehlungen aussprechen.

Warum so viele Migrant*innen in Mexiko verschwinden
Unzählige Menschen fliehen vor Gewalt, Armut, Perspektivlosigkeit aus Ländern wie Honduras, Guatemala oder El Salvador Richtung USA. Nach Schätzungen verschwinden täglich 30 von ihnen in Mexiko. Markus Plate beschreibt in seinem Beitrag, welche Rolle dabei organisierte Verbrecherbanden, staatliche Stellen und die weit verbreitete Straflosigkeit spielen. Und er schildert den mühsamen Kampf von Organisationen, die Angehörige bei der Suche nach ihren verschwundenen Familienmitgliedern unterstützen und sich für mehr Schutz vor dem gewaltsamen Verschwindenlassen einsetzen.
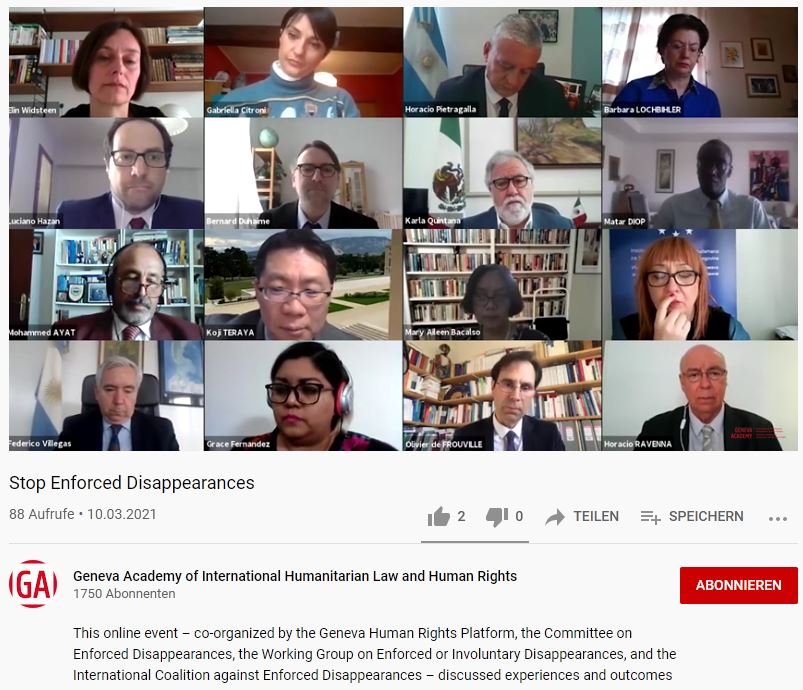
Mehr Staaten zum Beitritt bewegen
Wie können mehr Staaten dazu bewegt werden, der Internationaler Konvention gegen das Verschwindenlassen beizutreten? Was hat Norwegen überzeugt, nach vielen Jahren des Zögerns schließlich 2020 beizutreten? Welche Bedeutung hat es, dass Mexiko endlich die Kompetenz des Ausschusses gegen das Verschwindenlassen zur Prüfung von Individualbeschwerden anerkannt hat? Welche Strategien haben Nichtregierungsorganisationen im Kampf gegen das Verschwindenlassen und für den Beitritt zur Konvention gemacht? Diese Fragen und der Austausch von Erfahrungen waren Thema eines gemeinsamen Webinars, zu dem der Ausschuss und die Arbeitsgruppe sowie die Internationale Koalition gegen das Verschwindenlassen am 3. März 2021 eingeladen hatten. Die Hochkommissarin für Menschenrechte betonte im Eröffnungsstatement wie wichtig es ist, dass mehr Staaten als die bisherigen 63 der Konvention beitreten.

Leitprinzipien in Videos
In Mexiko werden immer noch viel zu viele Menschen gewaltsam verschwunden gelassen. Die Suche nach ihnen und Ermittlung der Verantwortlichen scheitern oft am Unvermögen der Behörden, komplizierten Zuständigkeiten und mangelnden Ressourcen, zum Beispiel für forensische Untersuchungen. Das UN Büro in Mexiko und das Rechtsstaatsprojekt der GIZ haben nun eine audiovisuelle Kampagne gestartet und mit Videos die „Leitprinzipien für die Suche nach verschwundenen Personen“ illustriert. Der UN Ausschuss gegen das Verschwindenlassen hat diese Richtlinien 2019 erarbeitet, um Mindeststandards für die Suche nach Verschwundenen zu setzen. Sie sollen den Staaten Grundsätze für die wirkungsvolle Suche nach Verschwundenen unter Einbeziehung der Angehörigen bieten und auch den Angehörigen selbst bei der Suche helfen. Viele dieser Verpflichtungen sind bereits in der Konvention formuliert, in den Leitprinzipien geht es um die konkrete und praktische Ausgestaltung und Umsetzung.
Bisher gibt es die Videos nur in spanischer Sprache. Untertitel sollen folgen.
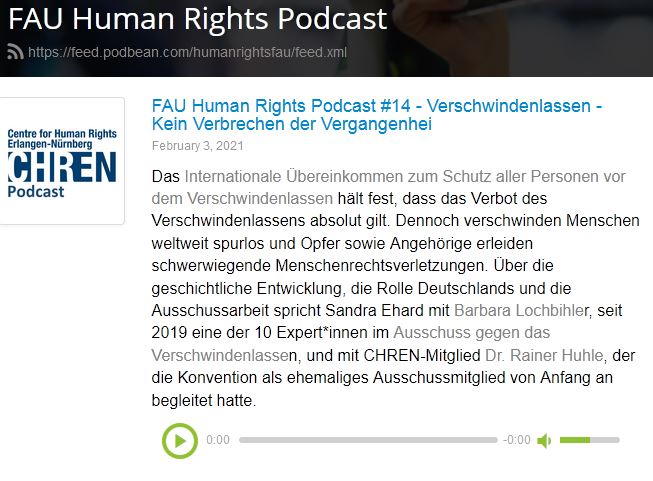
Podcast zum Verschwindenlassen
Im Menschenrechts-Podcast der FAU haben Rainer Huhle und ich über das gewaltsame Verschwindenlassen gesprochen und wie notwendig die Arbeit gegen diese schwere Menschenrechtsverletzung ist. Dabei ging es auch um die politische Verantwortung Deutschlands, um die Aussicht auf weitere Beitritte zur Konvention und die Mühen der Arbeit im UN Ausschuss gegen das gewaltsame Verschwindenlassen.
Der Podcast kann hier angehört werden und steht auch zum download bereit.

Drei herausragende Menschenrechts-verteidiger*innen für den Martin-Ennals-Preis nominiert
Soltan Achilova aus Turkmenistan, Loujain AlHathloul aus Saudi Arabien und Yu Wensheng sind für den diesjährigen Martin-Ennals-Award nominiert. Drei herausragende Menschenrechtsverteidiger*innen, die mit großem Mut für ihre Überzeugung kämpfen und sich von autoritären Regierungen nicht zum Schweigen bringen lassen.
Der Preis wird in diesem Jahr in einer Online-Zeremonie am 11. Februar verliehen. Mehr über die Finalist*innen auf der Webseite der Martin-Ennals-Stiftung.



