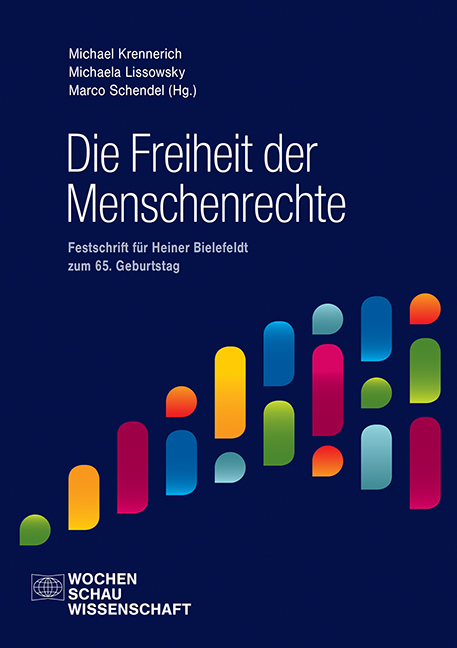
„Die Freiheit der Menschenrechte“
Heiner Bielefeldt ist nicht nur akademisch brillant an der Schnittstelle von Philosophie, Theologie, Politik- und Rechtswissenschaft. Er liebt es auch, mit Leidenschaft für seine Menschenrechtsthemen öffentlich einzutreten. Das konnte ich oft persönlich erleben – in seinem frühen Ehrenamt bei Amnesty International, als Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, als UN Sonderberichterstatter zu Religionsfreiheit und als Professor für Menschenrechte an der Friedrich-August-Universität Erlangen-Nürnberg.
Anlässlich Heiners 65. Geburtstag haben Kolleg*innen und Wegbegleiter*innen eine Festschrift herausgegeben mit Beiträgen aus zahlreichen Disziplinen zu normativen Grundlagen der Menschenrechte sowie Institutionen und Menschenrechtspolitik. Es ist mir eine Ehre, mit „Reflexionen zur Menschenrechtspolitik der Europäischen Union“ zu dieser Festschrift beigetragen zu haben.
Der Klappentext verspricht nicht zu viel, wenn es dort heißt „Ein vielseitiges Buch und ein Muss für alle an Menschenrechten Interessierten“.

Verschwindenlassen in Irak
Über den Besuch unserer Ausschussdelegation im Irak im November 2022 habe ich hier bereits ausführlich berichtet. Nun ist auch der Bericht dazu vom Ausschuss beraten und am 31. März offiziell angenommen worden. In einer Veranstaltung, zu der verschiedene NGOs eingeladen hatten, wurde diskutiert, welche Erwartungen nun an die irakische Regierung bestehen.
Der Bericht enthält klare Empfehlungen, was notwendig ist, um das erzwungene Verschwindenlassen im Land nachhaltig zu bekämpfen. Im ersten Teil wird dieses Menschenrechtsverbrechen im historischen Kontext und in aktuellen Mustern geschildert. Dies ist nicht zuletzt wichtig, um die immensen Herausforderungen einzuordnen, mit denen auch die politischen Akteure konfrontiert sind. Bei allem Verständnis für die schwierigen Umstände lässt der Bericht dennoch keinen Zweifel, dass irakische Regierung und Parlament in der Verantwortung sind, wirksam und gezielt gegen das Verschwindenlassen anzugehen. Im zweiten Teil wird dies ausführlich erläutert. Notwendig ist u.a., dieses Verbrechen endlich per Gesetz unter Strafe zu stellen, die Vielzahl von befassten Institutionen besser zu vernetzen und effektive Suchstrategien zu erarbeiten sowie die Verantwortlichen zu ermitteln und zu bestrafen. Vor allem gilt es, alle Opfer unabhängig von ethnischer Zugehörigkeit oder politischen Verdächtigungen bestmöglich bei der Suche nach verschwundenen Angehörigen zu unterstützen. Allzu oft sind sie bisher mit Ablehnung oder gar neuen Repressionen konfrontiert.
Wir sind uns bewusst, dass ein Bericht allein keine schnellen Lösungen hervorbringt. Aber wir hoffen, dass er zu weiterem Austausch mit der irakischen Regierung beiträgt und wir Stück für Stück zu Verbesserungen kommen.

Verschwindenlassen im Kontext von Migration und Flucht – Entwurf für Kommentar beschlossen
Das Risiko für Migrant*innen und Menschen auf der Flucht, Opfer von gewaltsamem Verschwindenlassen zu werden, ist in den vergangenen Jahren deutlich größer geworden. An den Außengrenzen der EU sind es menschenunwürdige und überfüllte Lager, gewaltsame Push-Backs und Leichen an den Mittelmeerstränden. In Zentralamerika sind es tausende Menschen in Flüchtlingskarawanen mit dem Ziel USA, die auf ihrem Weg der Gewalt durch guatemaltekische oder mexikanische Sicherheitskräfte und organisierte Kriminelle ausgesetzt sind. In Asien arbeiten Menschen ohne jegliche Absicherung für einen Hungerlohn auf Großbaustellen oder in Privathaushalten. Dies sind nur die besonders sichtbaren Beispiele dafür, welche Gefahren Menschen auf sich nehmen, um Krieg, Gewalt und Armut zu entkommen und ein besseres Leben zu finden. Ihre Wege werden gefährlicher, weil die Migrationspolitik weltweit immer restriktiver wird und legale Migrationswege zunehmend versperrt werden.
Der Ausschuss gegen das Verschwindenlassen hat sich in den vergangenen zwei Jahren intensiv mit dieser Entwicklung beschäftigt. Meine Kollegin Milica Kolaković-Bojović und ich sind Berichterstatterinnen für diesen Prozess und wir freuen uns sehr, dass der Ausschuss nun einen ersten Entwurf für eine „Allgemeine Bemerkung“ (General Comment) beschlossen hat. Darin werden die konkreten Verpflichtungen aus der Konvention zum Schutz von Migrant*innen vor dem Verschwindenlassen herausgestellt und die Staaten zu konkreten Maßnahmen aufgefordert, um Migrant*innen vor dem gewaltsamen Verschwindenlassen zu schützen und Angehörigen die Suche zu erleichtern.
NOGs, Opfer oder deren Vertreter*innen, Nationale Menschenrechtsinstitutionen, Wissenschaftler*innen, die Vertragsparteien, andere UN Ausschüsse oder Gremien oder regionale Menschenrechtsinstitutionen sind nun erneut eingeladen, den Entwurf bis zum 15. Juni zu kommentieren.
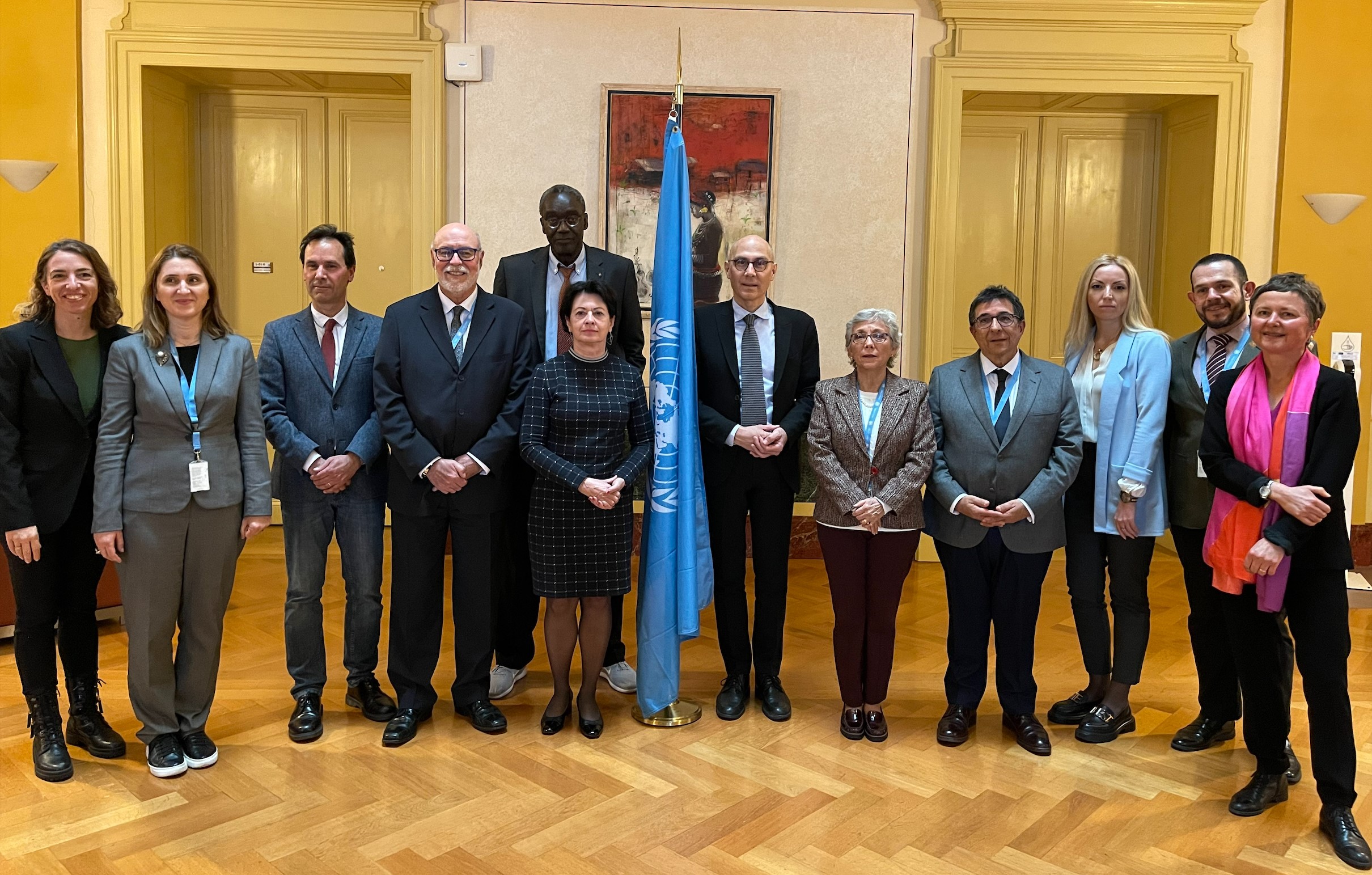
Hoher Besuch
Am 24. März hatten wir im Ausschuss Volker Türk zu Gast, der seit Oktober 2022 UN Hochkommissar für Menschenrechte ist. Ausführlich haben wir über unsere Arbeit im Ausschuss gesprochen sowie die unzureichenden Ressourcen und zahlreichen Herausforderungen für die Menschenrechtsarbeit der UN insgesamt. Wir waren uns einig, dass weit mehr als die bisher 71 Staaten die Konvention gegen das Verschwindenlassen ratifizieren müssen. Volker Türk sagte zu, im Monat August – in den der Internationale Tag für die Opfer des Verschwindenlassens fällt, ganz besonders aktiv dafür werben zu wollen.
Unseren „General Comment“ (Allgemeine Bemerkung) zum Thema Verschwindenlassen im Kontext von Migration nannte er notwendig und zeitgemäß. Auch er hält es für nötig, die verschiedenen UN Gremien und Arbeitsstränge zu Migration besser zu vernetzen und abzustimmen.
Die große Herausforderung, das gewaltsame Verschwindenlassen in Irak nachhaltig zu bekämpfen, sieht auch Volker Türk mit Sorge. Er wird voraussichtlich noch in diesem Jahr in das Land reisen und will für die Umsetzung unserer gerade veröffentlichten Empfehlungen (link) werben.

Joumana Seif für Engagement ausgezeichnet
Mit dem Anne-Klein-Frauenpreis wurde in diesem Jahr die syrische Frauen- und Menschenrechtsanwältin Joumana Seif ausgezeichnet. Das ist überaus verdient und hat mich aufrichtig gefreut, denn in den letzten Jahren hatte ich mehrmals Gelegenheit Joumana Seif zu treffen und von ihrem außergewöhnlichen und konsequenten Engagement zu hören. Nun traf ich sie wieder bei einem Austausch in kleinem Kreis mit Vertreterinnen der Zivilgesellschaft, den die Heinrich-Böll-Stiftung anlässlich der Preisverleihung organisiert hatte.
Joumana Seif setzt sich bereits seit 2001 für die Menschenrechte in Syrien ein. 2012 musste sie das Land verlassen. Seither steht die politische Partizipation von Frauen und die Anerkennung geschlechtsspezifischer Gewalt als Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Zentrum ihrer Arbeit. Sie gründete mit anderen u.a. in Berlin das „Syrian Women’s Network“, die „Syrian Feminist Lobby“ und das „Syrian Women’s Political Movement“. Die Auswirkungen des gewaltsamen Verschwindenlassens erfuhr sie persönlich bereits 1996, als ihr jüngerer Bruder – mutmaßlich verantwortet vom Geheimdienst – spurlos verschwindet: „Wenn jemand stirbt, kannst du trauern. Aber jahrelang mit der Hoffnung zu leben, dass er wiederkommt, zerstört dich innerlich.“ Etwa 130.000 Menschen gelten heute in Syrien als verschwunden.
In Deutschland hat sie über die letzten Jahre die syrischen Folterüberlebenden eng begleitet, die im Prozess vor dem Koblenzer Oberlandesgericht zu Folter und sexualisierter Gewalt in der Al-Khatib-Abteilung des Syrischen Geheimdienstes aussagten. Sie hat damit ganz wesentlich dazu beigetragen, dass die sexuelle Gewalt in Syrien in diesem Prozess als Verbrechen gegen die Menschlichkeit anerkannt und der Hauptangeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt wurde.
Herzlichen Dank, Joumana Seif, für diese unglaublich wichtige Arbeit und viel Erfolg beim Weitermachen!

Auf der Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit
„Mexiko ist ein extrem gefährliches Land für Migrant*innen“, sagte Ana Lorena Delgadillo, die sich seit Jahren für deren Rechte einsetzt. In Mexiko, wo offiziellen Zahlen zufolge mehr als 110.000 Personen verschwunden sind, stellen Migrant*innen eine besonders vulnerable und unterrepräsentierte Gruppe dar. Auf ihrem Weg Richtung Norden werden sie immer wieder Opfer von Menschenrechtsverletzungen, darunter gewaltsames Verschwindenlassen. Die Straflosigkeit für diese Verbrechen ist fast absolut.
Aber nicht nur in Zentralamerika ist dies ein wachsendes Problem. Auch in Afrika, in Asien und unübersehbar in Europa trägt die Kriminalisierung von Migration, die Abschottung von Grenzen und damit das boomende Geschäft von Schleusern und Menschenhändlern zunehmend dazu bei, dass Migrant*innen gewaltsam verschwinden.
Was also kann – und muss – die internationale Gemeinschaft tun, um dies zu verhindern, um Angehörige bei der Suche nach verschwundenen Migrant*innen zu unterstützen und Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen? Welche Herausforderungen und Schwierigkeiten gibt es speziell im Migrationskontext bei der Prävention, Aufklärung und strafrechtlichen Verfolgung von Fällen des Verschwindenlassens?
Darüber diskutierte ich am 1. März gemeinsam mit Ana Lorena Delgadillo (Direktorin der Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho) und zahlreichen interessierten Teilnehmer*innen eines Fachgesprächs, zu dem Brot für die Welt, die Deutsche Menschenrechtskoordination Mexiko und die Koalition gegen Verschwindenlassen einladen hatten. Ich nehme viele wichtige Informationen und Anregungen mit in meine Arbeit im UN Ausschuss gegen das Verschwindenlassen.

„Zemakomma“…
…ist schwäbisch und heißt „zusammenkommen“. Darum ging es beim Neujahrsempfang der Stadt Mindelheim, der nach pandemischer Pause Anfang 2023 wieder stattfinden konnte. Fast 300 Gäste aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft kamen und freuten sich über Begegnung und Austausch.
Ich war eingeladen, um als Festrednerin über Menschenrechte und Menschenwürde zu sprechen. Mit dem Krieg vor der Haustür, den protestierenden Menschen im Iran in allen Medien und dem Klimawandel überall hatte ich mehr als reichlich Anknüpfungspunkte. Für einen solchen Abend ist das schwere Kost, aber ich habe auch Fortschritte aufgezeigt und meine Überzeugung deutlich gemacht, dass es sich lohnt für die Menschenrechte zu kämpfen.
Die Augsburger Allgemeine hat über den Neujahrsempfang ausführlich berichtet.

Verschwindenlassen auch Thema in Den Haag
Die alljährliche Versammlung der Vertragsstaaten (ASP) des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) nahm ich zum Anlass für eine kurze Reise nach Den Haag. Das gewaltsame Verschwindenlassen, wenn es im Rahmen eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zivilbevölkerung begangen wird, ist als Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch im Römischen Statut ein Tatbestand, den es völkerstrafrechtlich zu ahnden gilt. In dessen Definition gibt es allerdings Unterschiede zu derjenigen in der Konvention gegen das Verschwindenlassen in Bezug auf die nachzuweisende Absicht der Täter und die längere Dauer des Verschwindens. Hier hoffen wir, dass seitens des ICC möglichst bald eine Interpretation erfolgt, die der Konvention entspricht. Bislang gibt es allerdings keine Entscheidung des IStGH zu diesem Tatbestand. Es war gut, darüber mit Jurist*innen am IStGH und ehemaligen Kolleg*innen der Parliamentarians for Global Action zu sprechen.

Die allgemeinen Debatten auf dieser ASP befassten sich mit dem wie immer zu knappen Budget des IStGH, den anstehenden Wahlen zum obersten Verwaltungsbeamten („Registrar“) und den oft schwierigen internen Arbeitsbedingungen beim IStGH. Interessant waren die zahlreichen Veranstaltungen zu Ländern und Themen, die besonders auch die Internationalen Koalition für den ICC organisiert hat. Teilweise war es den eingeladenen Jurist*innen und Anwält*innen nicht möglich sich öffentlich zu äußern, weil schon ihre Präsenz in Den Haag bei ihrer Rückkehr gefährlich sein könnte.
Sehr gut besucht war die von Deutschland und Südafrika organisierte Diskussion zu „Protecting women in armed conflict – is the current legal framework sufficient?“, auf deren Podium ich eingeladen war. Gemeinsam mit der Richterin Ute Hohoff, die sich hier als die deutsche Kandidatin für die IStGH Richterwahlen in 2023 vorstellte, Philipp Ambach, Chef des Opferbeteiligungssektion beim IStGH, Alex Whiting von der Anklagebehörde und Kathryn Bomberger, Direktorin der Internationalen Kommission für Vermisste Personen (ICMP) diskutierten wir intensiv, dass es vor allem auf die Anwendung und Umsetzung der bestehenden völker(straf)rechtlichen Regeln ankommt und es derzeit keine neue Gesetz auf internationaler Ebene braucht.
Die ICMP hat ihren Hauptsitz in Den Haag und feierte im letzten Jahr ihr 25jähriges Bestehen. Ich nahm mir einen halben Tag Zeit, um mich über deren Irakprogramm zu informieren und Möglichkeiten auszuloten, wie wir auch die interinstitutionelle Zusammenarbeit zwischen ICMP, der UN Working Group on Enforced and Involuntary Disappearances und unserem UN Ausschuss regelmäßiger gestalten können. Mit reichlich Druckerzeugnissen zu „Missing Persons From the Conflicts of the 1990s in the Former Yugoslavia and their Aftermath“ und deren neuem „Short guide for families of the missing“, im Gepäck reiste ich wieder ab.
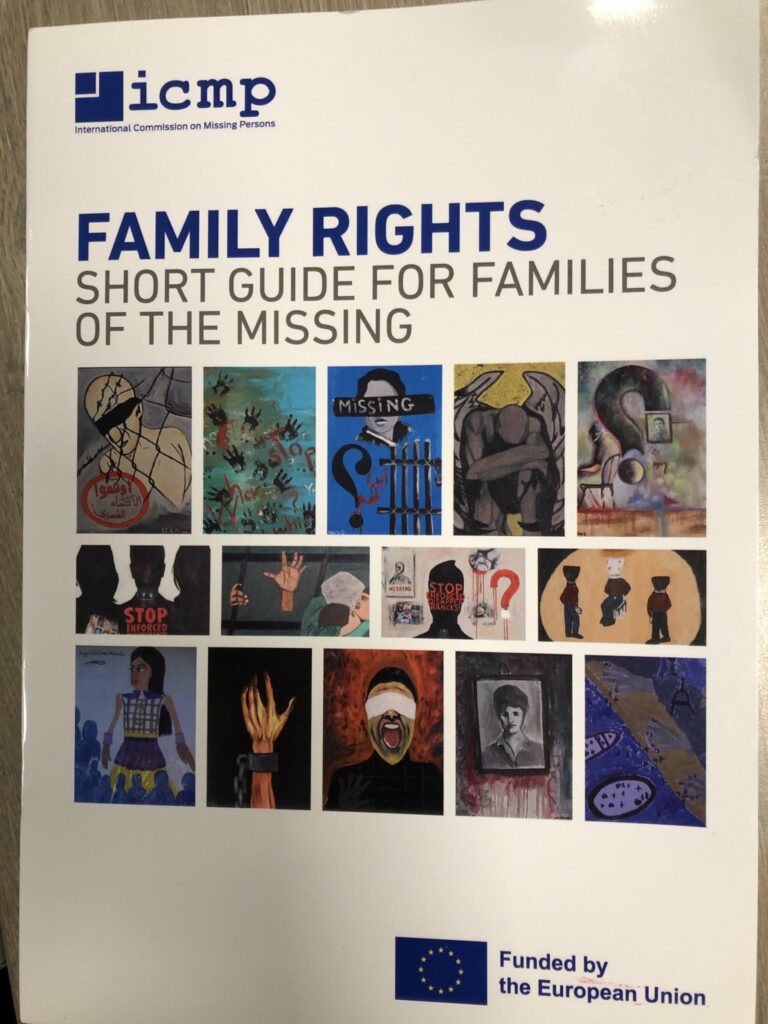

CED im Irak
Die Bekämpfung des gewaltsamen Verschwindenlassens im Irak ist eine riesige Herausforderung. Dies war mir als Berichterstatterin für den Irak im CED schon lange bewusst. Nun aber konnte ich mich gemeinsam mit unserer Ausschussvorsitzenden Carmen Rosa Villa Quintana und meinem Co-Berichterstatter Mohammed Ayat zwei Wochen vor Ort einen detaillierten und zugleich umfangreichen Eindruck verschaffen.
Die irakische Regierung hatte dem Besuch im November 2021 zugestimmt. Die Abstimmung von Besuchsorten, Einrichtungen, Gesprächspartner*innen waren nicht einfach, aber mit Unterstützung der Menschenrechtsexpert*innen der UN Mission UNAMI und in Kooperation mit dem irakischen Außenministerium arrangiert führte uns die Reise vom 11. bis 24. November schließlich nach Bagdad, Anbar, Bagdad, Erbil, Mosul und Sindschar. Wir führten 24 Gespräche mit mehr als 60 Behörden, mit vier Delegationen des irakischen Hochkommissariats für Menschenrechte in den besuchten Gouvernements und hatten sieben Treffen mit 171 Opfern und Organisationen der Zivilgesellschaft aus den Gouvernements Anbar, Bagdad, Kirkuk, Diyala, Erbil, Ninewa und Sallah Al Din. Wir führten Gespräche mit lokalen Vertreter*innen der UN, mit Diplomat*innen sowie mit internationalen Organisationen, die sich für den Schutz vor dem Verschwindenlassen einsetzen. Neben diesen vielen Gesprächen konnten wir eine Exhumierung begleiten, ließen uns die Arbeit in einem DNA-Identifizierungszentrum in Sindschar erläutern und besuchten vier Gefängnisse mit vorwiegend Daesh Gefangenen.

Die Leidensgeschichte der Menschen im Irak in Bezug auf das erzwungene Verschwindenlassen ist lang. Sie wird von irakischer Seite eingeteilt in die Zeit des Baath-Regimes von Saddam Hussein im föderalen Irak und in der Region Kurdistan (1968-2003), die Zeit nach 2003 und vor dem Auftreten des Daesh (des selbst ernannten „Islamischen Staats im Irak und der Levante“, ISIL), die Daesh-Besatzung und der gegen ihn gerichteten militärischen Operationen (2014-2017), sowie zuletzt die Anti-Regierungs-Demonstrationen 2019 und darauf folgende Ereignisse. Darüber hinaus hat unsere Delegation besorgniserregende Informationen über mutmaßliche Fälle von Verschwindenlassen in verschiedenen Gouvernements erhalten, bei denen anscheinend staatliche und nichtstaatliche Akteure zusammenwirken. Wir versprachen den Angehörigen nachzuhalten, soweit wir dies im Rahmen unserer Ausschussarbeit tun können.

Acht Jahre nach den Gräueltaten von 2014 an den Jesiden in Sindschar sind Tausende Jesid*innen noch immer nicht zu ihren Familien und Angehörigen zurückgekehrt. Ihr Verbleib ist nach wie vor ungeklärt. Daesh-Kämpfer trennten Männer und Jungen von Frauen und Mädchen, töteten Männer und betrieben Sklavenhandel mit den verschleppten Frauen und Mädchen. Wir hatten Gelegenheit mit einigen überlebenden Jesidinnen zu sprechen, die aus ihrer Sklaverei in Syrien in den Irak zurückgekehrt sind und nun versuchen ihr Schicksal zu meistern.

Auf dem Weg zu einer Exhumierung eines Massengrabes in Sindschar kamen wir durch ein damals überfallenes und seitdem völlig verlassenes Dorf. Es war furchtbar traurig, in den Ruinen noch die Spuren von Alltagsleben zu sehen – Satellitenschüsseln, Vorhänge, einzelne Flipflops. Die Exhumierung wurde durch lokale und internationale Expert*innen durchgeführt, im Beisein von Familien und Dorfbewohnern. An einer gemauerten Grube wurde der Deckel gehoben und wir konnten einige Leichenteile sehen. Die Exhumierungen der Massengräber von Daesh-Opfern im Irak werden in Kooperation zwischen irakischer Regierung und UNITAD (United Nations Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Da’esh/ISIL) durchgeführt, um die Einhaltung internationaler Standards sicherzustellen. Wir sprachen kurz mit den trauernden Verwandten und hörten ihre Forderung nach Schutz für die Jesid*innen. Sie wissen noch nicht, ob sie jemals wieder hierher zurückkehren wollen.

In Mosul besuchten wir eine DNA Identifizierungsstelle, wo Daten erfasst und DNA von überlebenden Verwandten mit gefundenen Körperteilen abgeglichen wird. Diese Daten sind auch für den Abgleich mit Listen von Verschwundenen wichtig. Zudem ist der Erhalt eines Totenscheins Voraussetzung für die Beantragung von Entschädigungsleistungen. An der Wand hing ein Poster von Nadja Murad und Lamija Haji Bashar, denen das EP 2018 den Sacharovpreis verliehen hatte. Beide erlitten unbeschreibliche Gräueltaten durch den Daesh und setzen sich engagiert für den Schutz und die Rechte der Jesid*innen ein. Das Bild war für mich ein kleiner Lichtblick in einer Situation kaum erträglichen Leidensgeschichten.

In Bagdad führten wir ausführliche Gespräche mit Vertreter*innen von Justiz-, Innen- und Außenministerium, des Menschenrechtsausschusses im Parlament, und mit Menschenrechtsorganisationen. Hier ging es um die Klärung von Prozeduren zwischen den Ministerien und eigens zu Verschwindenlassen eingesetzten Institutionen sowie der schon lange im Parlament anstehenden Gesetzesinitiative für einen Straftatbestand des Verschwindenlassens. Dies fordert CED schon seit 2019, es scheitert aber immer wieder an den politischen Verhältnissen. Nun sind wir auf Wahlen und ein neue Regierung im Frühjahr 2023 vertröstet worden. Eine solche gesetzliche Regelung ist eine grundsätzliche Voraussetzung, um gegen die verbreitete Straflosigkeit angehen zu können.
Die Suche nach verschwundenen Personen lässt die Angehörigen oft verzweifeln. Das Zusammenwirken von Behörden hierbei ist sehr unübersichtlich und kaum koordiniert, Unverständnis und nicht selten auch Unwillen ist weit verbreitet. Ein zentrales Datenregister, das die Informationen von allen verantwortlichen Autoritäten und Institutionen zusammenführt und so die Identifizierung von vermutlichen und bestätigten Fällen von erzwungenem Verschwindenlassen ermöglicht, gibt es nicht. Ebenso fehlt eine systematische Registrierung von Hafteinrichtungen und dort festgehaltenen Personen. Die suchenden Angehörigen werden von einer zur anderen Stelle verwiesen. Eine Mutter von drei verschwundenen Söhnen sagte uns „Jedes Mal, wenn ich den Behördenstellen das Verschwinden meiner Söhne erkläre, geht es mir sehr schlecht. Ich zittere, ich weine, ich kann nicht mehr schlafen. Ich habe alle Hoffnung verloren. Und jetzt bin ich sehr krank. Papiere, Papiere, und sonst passiert nichts. Wir haben keine Unterstützung.“
Es bleibt die Hoffnung, dass die irakische Regierung erkennt, wie dringend notwendig die verbesserte Suche nach den vielen Verschwundenen ist, und entsprechend handelt. Wenn die vielen Familien aus den verschiedenen Regionen des Landes das Vertrauen in den politischen Willen der Regierung zur Aufklärung verlieren, wird Versöhnung schwierig, bis unmöglich.
Wir werden die Erkenntnisse unseres Besuches im gesamten CED erörtern und einen Bericht mit umfassenden Empfehlungen im März 2023 veröffentlichen.


Menschenrechte in Professionen
Wie wird man „Menschenrechtsprofi“ und warum? Was brauchen diejenigen für ihre Arbeit, die ihr Berufsleben in NGOs, in der Wissenschaft, bei den Vereinten Nationen und anderswo den Menschenrechten widmen, die als Multiplikator*innen in die Breite der Gesellschaft wirken und als Lobbyist*innen für eine menschenrechtsbasierte Politik kämpfen? Und welche Folgen hat es, wenn unzureichende Gesetze, mangelnde Ressourcen und menschenrechtsfeindliche Diskurse die professionelle Menschenrechtsarbeit erschweren oder gar unmöglich machen?
In der Zeitschrift für Menschenrechte 2/2022 habe ich dazu mit meiner Kollegin einen Artikel veröffentlicht. Diese aktuelle Ausgabe mit dem Themenschwerpunkt „Menschenrechte in Professionen“ beinhaltet sowohl Erfahrungsberichte aus der praktischen Menschenrechtsarbeit als auch wissenschaftliche Beiträge von Autor*innen, die sich mit Menschenrechten in ihren Berufen beschäftigen.
Die Zeitschrift kann beim Wochenschau-Verlag bestellt oder in vielen Bibliotheken gelesen werden.



