
Podcast zum Tag der Menschenrechte
Zum Tag der Menschenrechte habe ich im Podcast des ifa Institut für Auslandsbeziehungen darüber gesprochen, wie es derzeit weltweit um die Menschenrechte bestellt ist. Ich wurde gefragt, was Außenkulturpolitik angesichts zunehmender Einschränkung der zivilgesellschaftlichen Handlungsspielräume für ihre Stärkung tun kann. Und habe geantwortet… – reinhören!
Elisabeth-Selbert-Initiative zum Schutz von Menschenrechtsverteidiger*innen
Vor einigen Monaten wurde vom Auswärtigen Amt nach langjährigen Forderungen der Zivilgesellschaft ein Schutzprogramm für Menschenrechtsverteidigerinnen und Menschenrechtsverteidiger eingerichtet, benannt nach einer der vier „Mütter des Grundgesetzes“ Elisabeth Selbert. Ziel ist die Unterstützung und der Schutz vor Ort für Akteur*innen, die sich für Menschenrechte einsetzen, und für den Fall akuter Bedrohung ein Schutzaufenthalt in Deutschland. Ich freue mich, dass ich als Mitglied im unabhängigen Auswahlgremium diese wichtige Initiative unterstützen kann. Mehr Informationen zur Elisabeth-Selbert-Initiative gibt es hier.

20 Jahre UNSCR 1325 – ein trojanisches Pferd für die Frauenbewegung?
Vor 20 Jahren wurde die Agenda Frauen Frieden, Sicherheit auf den Weg gebracht, beschlossen vom UN Sicherheitsrat mit der Resolution 1325. In Deutschland wird die Agenda mit einem Nationalen Aktionsplan umgesetzt, aber dies erfolgt im Wesentlichen durch geschlechtersensitive Anpassungen von außen- und sicherheitspolitischen Maßnahmen. Der Anspruch der Agenda ist jedoch weitreichender und verlangt eine strukturelle und kohärente Integration in die Arbeit der deutschen Bundesregierung. Dies bedeutet nicht nur Lösungen für Frauen in bestehenden geschlechterungerechten Systemen zu finden, sondern vielmehr die Systeme geschlechtergerecht neu zu gestalten und an Menschenrechte anzupassen.
Was das im Hinblick auf Abrüstung, Klimagerechtigkeit, Migration und andere Politikfelder bedeutet, hat die WILPF in einer beachtenswerten Stellungnahme ausgearbeit.
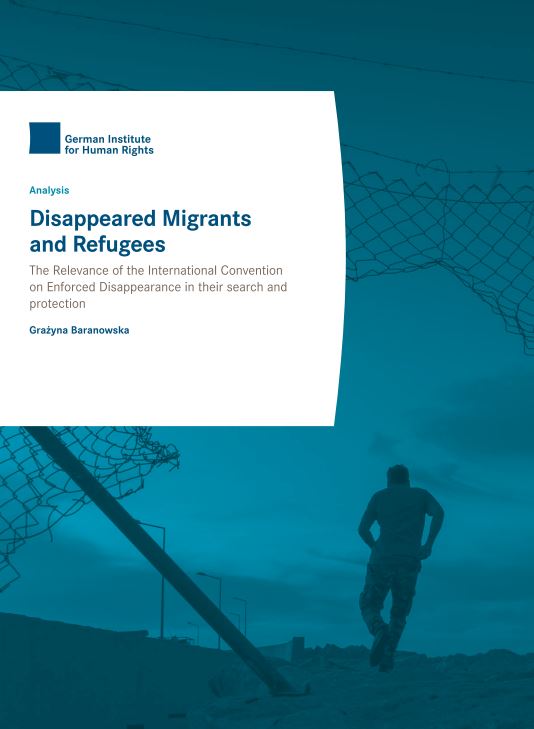
Schutz von Migrant*innen und Flüchtlingen vor dem Verschwindenlassen
Die immer gefährlicheren Wege, auf denen Migrant*innen und Flüchtlingen unterwegs sind, und die immer rigider werdende Migrationspolitik der Staaten erhöhen deutlich das Risiko für Migrant*innen und Flüchtlinge, Opfer von gewaltsamem Verschwindenlassen zu werden.
Auf meine Initiative hin hat das Deutsche Institut für Menschenrechte nun eine Studie veröffentlicht, welche konkreten Verpflichtungen zum Schutz von Migrantinnen vor dem Verschwindenlassen die Internationale Konvention enthält. Wie müssen Staaten grenzübergreifend nach Verschwundenen suchen? Welche Rechte haben Familienangehörige von verschwundenen Migrantinnen gegenüber diesen Staaten? An wen können sie sich wenden und wo können sie mutmaßliches Verschwindenlassens eines/einer Migrantin anzeigen? Wie verhält es sich, wenn das Verschwindenlassen durch nicht-staatliche Akteure, aber mit dem Wissen von staatlichen Bediensteten geschieht, etwa in Fällen von Menschenhandel?
In Bezug auf Migrant*innen und Flüchtlinge tragen alle Staaten und insbesondere die Vertragsstaaten der Internationalen Konvention gegen das Verschwindenlassen Verantwortung. Sie sind rechtlich verpflichtet, Migrant*innen vor dem gewaltsamen Verschwindenlassen zu schützen oder nach ihnen zu suchen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Doch allzu oft sind diejenigen, die zu Recht behaupten, beim Schutz der Menschenrechte an vorderster Front zu stehen, plötzlich sehr still, wenn es um Migration geht.
Die Studie will dazu beitragen, eine der vielen Lücken zwischen Menschenrechten und Migrationspolitik zu schließen.

Viele Fragen, wichtige Antworten zum Verschwindenlassen im Irak
Am 5. und 7. Oktober konnte der Ausschuss gegen das Verschwindenlassen den Dialog mit Vertreter*innen der irakischen Regierung nachholen. Es war das erste Mal überhaupt, dass ein UN Vertragsausschuss solch einen Austausch ONLINE durchführt, verbunden mit großem technischen Aufwand. Die irakische Delegation unter Leitung des Justizministers war aus Bagdad zugeschaltet, wir Ausschussmitglieder aus unseren Heimatorten von Tokio bis Peru, und das Sekretariat im gespenstisch leeren Sitzungssaal in Genf.
In der ersten Sitzung ging es vor allem um das längst überfällige Gesetz, mit dem das gewaltsame Verschwindenlassen im Irak endlich strafbar werden soll, so wie es die Konvention vorsieht. Der Justizminister betonte, dass von zahlreichen anstehenden Gesetzesvorhaben dieser Entwurf mit Priorität ins Parlament gebracht werden solle. Eine Mehrheit dafür ist aber noch nicht sicher. Zudem haben wir betont, dass mit dem Gesetz Strafverfolgung aller Verantwortlichen möglich sein muss. Es darf auch nicht unterschieden werden zwischen den Opfern des Baath-Regimes, den von ISIL/Daesh oder während dessen Bekämpfung Verschwundenen, und den Menschen, die seit den im Oktober letzten Jahres begonnenen Demonstrationen gegen die Regierung gewaltsam verschwunden wurden.
Einig waren wir uns mit der irakischen Delegation, dass die Klärung des Schicksals tausender Opfer von erzwungenem Verschwindenlassen im Irak eine riesige Herausforderung ist. Vermutlich über eine Million toter Personen in gesicherten und ungesicherten Massengräbern müssen unbedingt erfasst und identifiziert werden. Das bedarf großer finanzieller und technischer Unterstützung.
Nicht einig waren wir uns über die Existenz von unzähligen Geheimgefängnissen, in denen Menschen festgehalten werden, und niemand Auskunft erhält, wer dort war und ist. Unser Ausschuss bekommt immer wieder glaubwürdige Hinweise darauf, doch die Regierung antwortete mehr als ausweichend.
Beide Sitzungen – vom 5. Oktober und vom 7. Oktober – sind im WebTV der UN dokumentiert.
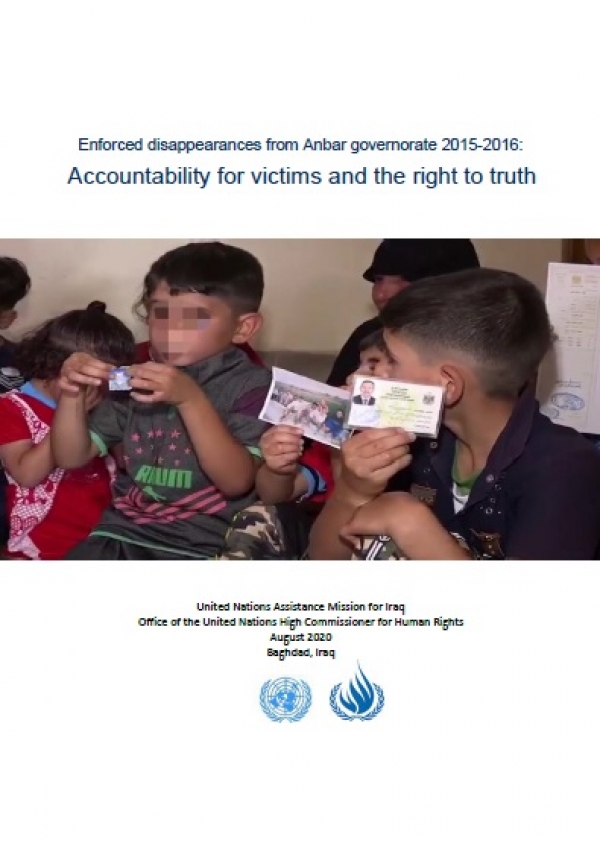
Covid-19 verhindert Dialog mit dem Irak
Vertreter*innen der irakischen Regierung sollten diese Woche mit dem UN Ausschuss gegen das Verschwindenlassen ausführlich über die vielen unaufgeklärten Fälle von gewaltsam Verschwundenen im Land diskutieren. Doch Covid-19 hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Acht Mitglieder der irakischen Delation sind erkrankt, die übrigen in Quarantäne, und so muss dieser Dialog leider verschoben werden.
Wir haben jedoch zur Vorbereitung mit irakischen Opfer- und Menschenrechtsorganisationen diskutiert, die unter schwierigen Bedingungen vor Ort arbeiten. Auch mit Vertreter*innen der UN im Irak haben wir uns beraten, die vor kurzem einen ausführlichen Bericht zur Situation im Irak veröffentlichten. Hierin geht es vor allem um die über 1.000 Menschen, die 2015-2017 während der Kämpfe zur Vertreibung von Daesh/ISIL aus der Provinz Anbar mutmaßlich von Sicherheitskräften der Regierung und regierungsnahen Milizen verschwunden wurden. Das Verschwinden von tausenden Menschen, die tatsächlich oder vorgeblich verdächtigt werden ISIL zu unterstützen, ist ein großes Problem im ganzen Land. Hinzu kommen Fälle von verschwundenen Demonstrant*innen während der öffentlichen Proteste gegen die irakische Regierung seit Oktober.
Ausnahmslos alle Gesprächspartner*innen beklagten den fehlenden politischen Willen, die Forderungen aus der Konvention gegen Verschwindenlassen auch umzusetzen. Der Premierminister Mustafa Al-Kadhimi traf sich Ende August mit Angehörigen von Verschwundenen, versprach Ermittlungen und wies darauf hin, dass es nun bald das schon lange bearbeitete Gesetz, das gewaltsames Verschwindenlassen unter Strafe stellt, geben wird. Dies ist ein positives Zeichen, das aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass es Jahren viele Versprechen und kaum Umsetzung gibt.

Corona, Heimat und Menschenrechte
Zu Gast im „Salon Zukunft Heimat“ habe ich mit Norbert Göttler über Menschenrechte und die Auswirkungen der Pandemie auf regionales und globales Denken gesprochen. Neigt die Menschheit dazu, infolge der Corona-Pandemie in Provinzdenken zu verfallen? Verliert die Gesellschaft darüber den Willen zum globalen Handeln? In diesem Podcast können Sie unser Gespräch anschauen und anhören. Auch die Süddeutsche Zeitung hat darüber berichtet.

Verschleppt, gefoltert, getötet: Internationaler Tag gegen das Verschwindenlassen
Der Kampf gegen das gewaltsame Verschwindenlassen ist auch heute unverändert wichtig. Das berichtet der Artikel unter anderem an den besonders kritischen Situationen in Mexiko und dem Irak. Im Gespräch mit dem Autor habe ich auch deutlich gemacht, warum das Verschwindenlassen ist ein ganz spezifisches Unrecht ist.
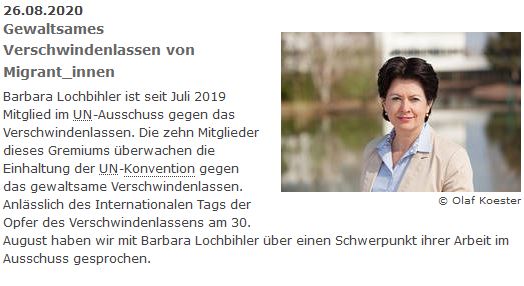
Internationaler Tag der Opfer des Verschwindenlassens
Migrant*innen sind besonders gefährdet, Opfer von gewaltsamem Verschwindenlassen zu werden. Über diesen Schwerpunkt meiner Arbeit habe ich anlässlich des Internationalen Tags der Opfer des Verschwindenlassens im Interview mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte gesprochen.
Auch im Rahmen der Aktion zum Schutz von Migrant*innen vor Verschwindenlassen habe ich über dieses Thema in einem Video-Interview gesprochen. Dabei bin ich auch gefragt worden, wie jede*r von uns dazu beitragen kann, um MIgrant*innen und Flüchtlinge vor dieser Menschenrechtsverletzung zu bewahren.
Wie Staaten der EU oder die USA mit ihrer Politik der Abschottung, der „sicheren Drittstaaten“ und Kooperationen mit brutalen „Sicherheitskräften“ auf den Transitrouten den Weg für Migrant*innen noch gefährlicher machen, berichtet dieser Artikel.

Drei Rebellinnen gegen den Krieg berichten
Vor drei Jahren hat die WILPF den „Anita-Augspurg Preis an eine Rebellin gegen den Krieg“ ins Leben gerufen. In diesem Video berichten die drei bisherigen Preisträgerinnen Zaina Erhaim aus Syrien (2017), Gulnara Shahinian aus Armenien (2018) und Rasha Jarhum aus dem Jemen (2019) über ihre Arbeit und wie sie das Preisgeld für ihr Engagement nutzen konnten.
In diesem Jahr kann leider keine Preisverleihung stattfinden. Bis zum Jahresende 2020 nimmt die WILPF aber Vorschläge für eine neue Preisträgerin entgegen. Auch Spenden werden gesammelt für die nächste Preisverleihung.



